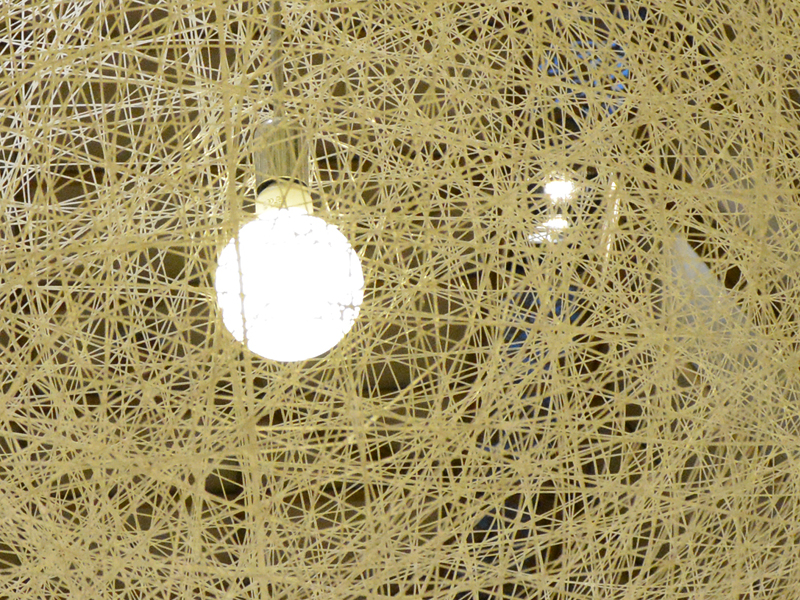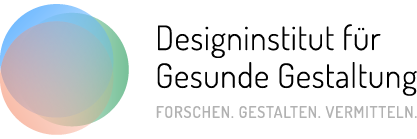Gestaltung in all ihren Facetten kann oft auch als forschende Tätigkeit verstanden werden. Viele Entwürfe fordern bereits zu Beginn des Entwurfsprozesses oder gar noch vor einem echten Briefing eine grobe Recherche des Nutzungskontexts. Auch im späteren Verlauf des Entwurfs basiert ein guter Gestaltungsprozess auf forschenden Tätigkeiten, indem etwa Materialien auf ihre ästhetischen Eigenschaften untersucht werden oder Skizzen in explorativer Weise überarbeitet und diskutiert werden. Nicht zuletzt spielt hierbei Intuition und das berühmte „Bauchgefühl“ eine sehr wichtige Rolle. Ohne chaotische und zufällige Entwicklungen würde der Designprozess wahrscheinlich in großem Maße an Kreativität und Innovationskraft verlieren.
Gleichzeitig lässt sich in der Werkzeugkiste empirischer Forschungsmethoden eine Vielzahl angebrachter Tools finden, die Gestalter und Designforscher im Rahmen des Entwurfsprozesses stark unterstützen können. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den medizinischen Kontext von äußerst großer Bedeutung. Empirische Forschungsmethoden bieten dabei Ansätze, um Entwürfe sowohl zu informieren als auch zu evaluieren. Außerdem können sie (wenn richtig eingesetzt) auch in enormen Maße kreative Impulse und neue Blickwickel ermöglichen.

Empirische Forschungsmethoden